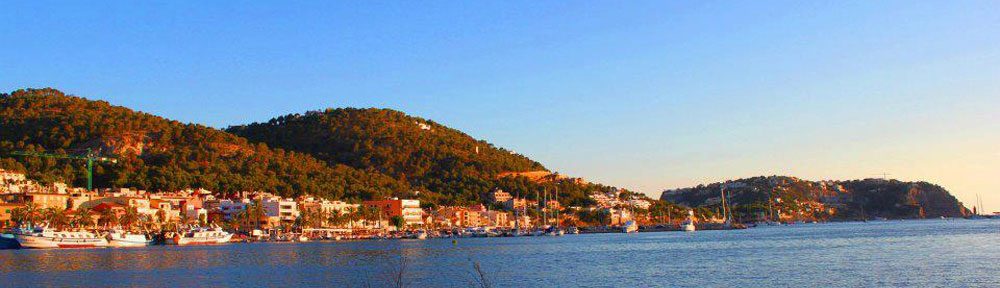Messies horten Dinge, die andere Menschen als unbrauchbar wegwerfen. Das Phänomen wird bei unserem strategischen Ansatz als eine besondere Form der Zwangsstörung betrachtet. Dabei steht das Sammeln im Mittelpunkt. In der US-Literatur wird daher auch von „compulsive hoarding“ gesprochen.
Das äußerliche Chaos spiegelt oft die innere Unordnung des Betroffenen wider. Menschen mit diesem Syndrom haben häufig Probleme, ihren Alltag zu organisieren. Insbesondere gilt dies hinsichtlich der Planung und Zeiteinteilung sowie der Schwierigkeit, den anstehenden Aufgaben gerecht zu werden.
Es fällt ihnen schwer, Prioritäten zu setzen, dringend Notwendiges schnell zu erledigen und so vorzugehen, dass sie ein selbst gestecktes Ziel erreichen. Die Mehrheit der Betroffenen wird erst ab Mitte 30 von der Störung beeinträchtigt.
Oft kreisen ihre Gedanken darum, wie sie alltägliche Aufgaben wie Haushaltsführung oder die Koordination on Terminen bewältigen können. Überfordert vom Alltag empfinden Messies ihr Leben als zerrissen und chaotisch. Sie leiden oft unter Ängsten, einem mangelnden Selbstwertgefühl und sind innerlich sehr angespannt.
Häufig sind die Probleme mit frühkindlichen Bindungsstörungen und mangelnder Zuwendung der Eltern assoziiert. Um die fehlende Nähe und Verlustängste zu kompensieren, bauen sie emotionale Beziehungen zu den Gegenständen auf, die sie sammeln. Es ist der Versuch, Löcher in der Seele zu stopfen. Es herrscht eine Diskrepanz zwischen innerer und äußerer Welt vor. Dem Betroffenen gelingt es nicht, die eigenen Wünsche und Triebe mit den äußeren Anforderungen in Einklang zu bringen.
Nach einer Studie der Universität Freiburg leiden 76% der Klienten an mindestens einer weiteren psychischen Erkrankung wie einer Depression oder einer Angststörung. Zusätzlich zu dem zwanghaften Horten kann es zu einem ausgeprägten Kontrollverlust wie einer Kaufsucht kommen. Zwang und Sucht sind 2 Seiten der gleichen Medaille.
Wir betrachten das Messie-Syndrom deshalb nur in seiner einfachsten Ausprägung als „Desorganisationsproblem“, das sich relativ leicht behandeln lässt. In seiner Kernsymptomatik ist es aber in seiner vollen Ausprägung gekennzeichnet durch Aufschieben, Anhaften sowie Ordnungs- und Wertbeimessungsstörungen.
Bei der Therapie besteht die Schwierigkeit darin, sich von emotional besetzten Gegenständen zu lösen. Die Trennung wird häufig als Teil des Verlustes der eigenen Identität erlebt und ist in hohem Maß mit Angst besetzt. Gemeinschaftlich wird der Versuch unternommen, die hohe emotionale Bindung an Gegenständen schrittweise zu verringern und diese prioritätenmäßig von „am einfachsten“ bis „am schwersten“ ohne Schuldgefühle wegzugeben. Dabei wird vom „wichtigsten“ Raum in der Wohnung zum „unwichtigsten“ vorgegangen, um möglichst rasch für den Klienten sichtbare und erlebbare Erfolge zu erzielen, die ihn zur Weiterarbeit motivieren. Am Anfang steht eine umfangreiche Exploration mit einem speziellen Fragekatalog („Hoarding Interview“), die die Basis für die Therapie darstellt.